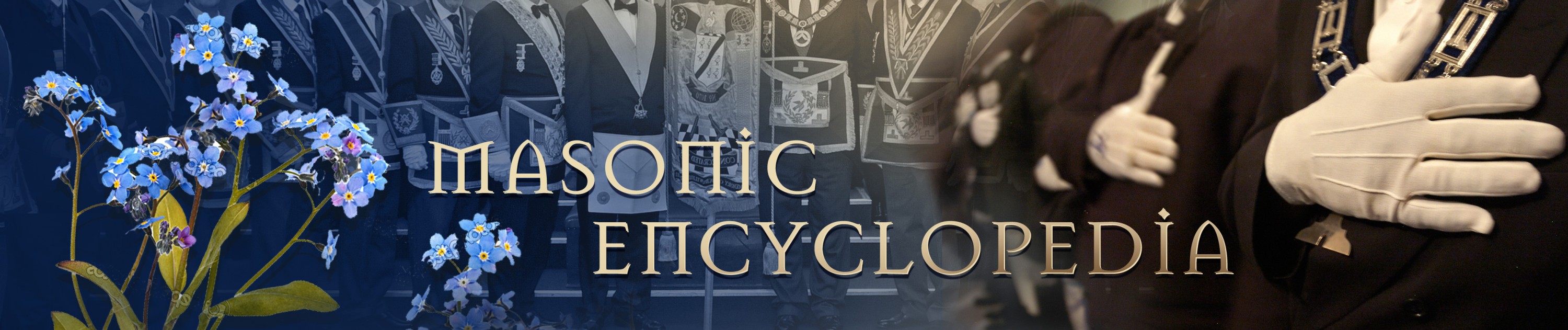|
|
| Zeile 1: |
Zeile 1: |
| | | #REDIRECT[[Hans-Hermann Höhmann: Freimaurerei - Freimaurerei in Deutschland]] |
| == Freimaurerei in Deutschland: Ein Überblick im Kontext von Geschichte, internationalen Entwicklungen und freimaurerischen Konzeptionen ==
| |
| | |
| | |
| »Sieh, Konstant, so steht es mit dem Orden, dessen Geheimnis Du ergründen willst; über
| |
| den Verfolgung und Spott, Unwissenheit und Verrat nichts vermögen. So wie man zuweilen
| |
| im Spaß gesagt hat: Das größte Geheimnis der Freimaurer ist, dass sie keins haben; so
| |
| kann man mit Recht sagen: das offenbarste und dennoch geheimste Geheimnis der Freimaurer
| |
| ist, dass sie sind und fortdauern. Denn – was ist es doch, was kann es doch sein,
| |
| das alle Menschen von der verschiedensten Denkart, Lebensweise und Bildung zusammen
| |
| verbindet und unter tausend Schwierigkeiten, in dieser Zeit der Erleuchtung und
| |
| Erkaltung, beieinander erhält?«
| |
| | |
| Johann Gottlieb Fichte: Philosophie der Maurerei. Briefe an Konstant
| |
| | |
| | |
| == Vorbemerkung ==
| |
| | |
| Freimaurerei ist ein weltweiter Freundschaftsbund, und gilt – so die Internetseiten vieler USamerikanischer
| |
| Großlogen – als »the largest and oldest fraternity in the world«.1 Freimaurerei
| |
| stellt aber auch eine spezifische symbolisch-rituelle Lehr- und Erfahrungsmethode dar,
| |
| die von Anfang an auf Einübung einer ethisch fundierten Art und Weise der Lebensführung
| |
| angelegt war: »A Mason is oblig’d, by his Tenure, to obey the moral Law« hieß es bereits in
| |
| den »Andersons Konstitutionen« von 1723, und eine spätere, viel zitierte Definition, ebenfalls
| |
| aus der englischen Freimaurerei, nahm diesen Gedanken auf: »Freemasonry is a peculiar
| |
| system of morality, veiled in allegory, and illustrated by symbols«. Freimaurerei versucht
| |
| dabei, die gesellige, die intellektuelle und die emotionale Seite des Menschen gleichermaßen
| |
| anzusprechen. Verstand und Gefühl werden nicht getrennt, und insbesondere die in den Logen
| |
| geübte Ritualpraxis soll dazu beitragen, Einsichten in Lebenswirklichkeiten gleichzeitig
| |
| denkend und fühlend zu gewinnen.
| |
| | |
| Freimaurerei stellt allerdings keine Einheit dar. Von Beginn an gab es unterschiedliche
| |
| Erscheinungsformen des Freimaurerbundes, die sich – mit der Entwicklung von Hochgradsystemen
| |
| – vor allem in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts weiter ausdifferenziert
| |
| haben. Viele damit verbundene Forschungsfragen sind bisher unbeantwortet, doch
| |
| hat besonders seit den 1950er Jahren eine intensive multidisziplinäre wissenschaftliche
| |
| Beschäftigung mit der Freimaurerei eingesetzt, an der in zunehmendem Maße auch Wissenschaftler
| |
| an Universitäten und Forschungsinstituten teilnehmen, die selbst nicht dem
| |
| Freimaurerbund angehören. In Deutschland sind die wichtigsten dieser Forscherinnen und
| |
| | |
| 1 So z.B. Grand Lodge of Michigan, www.gl-mi.org.
| |
| | |
| | |
| Forscher am »[[Netzwerk Freimaurerforschung]]« beteiligt, das im Jahre 2001 in Anlehnung
| |
| an die Universität Bielefeld begründet wurde.
| |
| | |
| 2
| |
| Der folgende einleitende Beitrag des Bandes soll die historisch-analytische Basis für die
| |
| folgenden Untersuchungen und Überlegungen schaffen. Er verbindet zentrale Gesichtspunkte
| |
| der freimaurerischen Geschichte und Ritualistik mit analytischen Gesichtspunkten
| |
| und Hypothesen zum Verständnis der sozialen Struktur des Freimaurerbundes und einem
| |
| Aufriss von Selbstverständnis, Problemen und Entwicklungstendenzen der deutschen Freimaurerei
| |
| am Beginn des 21. Jahrhunderts.
| |
| | |
| | |
| == Zentrale Aspekte der Geschichte des Freimaurerbundes ==
| |
| | |
| Der folgende Abschnitt beansprucht nicht, die Geschichte des Freimaurerbundes zusammenfassend
| |
| oder gar detailliert zu beschreiben. Er ist vielmehr auf ein Aufzeigen und Erörtern
| |
| von Aspekten angelegt, die mir für die Beurteilung von Entstehung und Entwicklung
| |
| der Freimaurerei wichtig erscheinen. Der Freimaurerbund ist ein Produkt der Moderne. Entwicklungsanstöße
| |
| und Strukturmaterial aus der älteren Geschichte aufnehmend, entstand
| |
| er als soziale Gruppierung von Gewicht zu Beginn des 18. Jahrhunderts in England und
| |
| blickt inzwischen auf eine Entwicklung von fast 300 Jahren zurück. Die Vorgeschichte des
| |
| Bundes reicht weiter zurück und beginnt mit den mittelalterlichen und frühneuzeitlichen
| |
| Steinmetzbruderschaften und deren Bauhütten, aus denen (und unter Bezug auf die) sich
| |
| nach 1717, dem Jahr der ersten Großlogengründung, fast explosionsartig die modernen Freimaurerlogen
| |
| entwickelten. Die Einzelheiten dieser »großen Transformation« von den Bauhütten
| |
| der Steinmetze zu den Logen der »Gentlemen Masons« liegen immer noch im Dunkel
| |
| der Geschichte und sind Gegenstand wissenschaftlicher Hypothesen sowie vielfältiger
| |
| Spekulationen. Insbesondere ist noch nicht hinreichend geklärt, ob und inwieweit es sich
| |
| bei dem, was später als »Esoterik der Freimaurerei« bezeichnet werden sollte, um das Ergebnis
| |
| eines allmählichen, durch die Bauhütten des Mittelalters und der frühen Neuzeit vermittelten
| |
| Einfließens alter Denkformen und Symbole in die Freimaurerei hinein handelt oder
| |
| ob das zunehmende Gewicht der Esoterik in der Maurerei der zweiten Hälfte des 18. und
| |
| der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts Resultat eines großen Prozesses des Einsammelns hermetischer,
| |
| symbolischer und gedanklicher Elemente aus der Kultur- und Religionsgeschichte
| |
| des Abendlandes gewesen ist und insofern mehr mit Rückprojektionen als mit Kontinuitäten
| |
| zu tun hat.
| |
| Die wissenschaftliche Aufarbeitung der freimaurerischen Vergangenheit wird nicht nur
| |
| durch die oft spärliche Quellenlage erschwert, vor allem, was die Praxis der frühen Freimaurerei
| |
| betrifft. Hinzu kommt, dass quellengestützte Forschungsergebnisse nicht selten durch
| |
| Entstehungslegenden überlagert werden, die aus der Freimaurerei selbst stammen. John
| |
| 2 Das Netzwerk Freimaurerforschung wurde im Rahmen des Forschungsprojekts »Deutsche Freimaurerei
| |
| der Gegenwart – Zur Wechselwirkung von (post)moderner Geselligkeit und bürgerlicher Gesellschaft«
| |
| an der Universität Bielefeld eingerichtet und von folgenden Forscherinnen und Forschern initiiert: Prof.
| |
| Dr. Jörg Bergmann (Bielefeld), Prof. Dr. Klaus Hammacher (Aachen), Prof. Dr. Hans-Hermann Höhmann
| |
| (Köln), Dr. Stefan-Ludwig Hoffmann (Bochum), Dr. Florian Maurice (München), Prof. Dr. Monika
| |
| Neugebauer-Wölk (Halle-Wittenberg), Prof. Dr. Linda Simonis (Köln) und Prof. Dr. Jan Snoek
| |
| (Heidelberg). Homepage: http://www.freimaurerforschung.de/.
| |
| | |
| 14
| |
| Hamill unterscheidet in seiner Geschichte der englischen Freimaurerei3 »authentische«
| |
| (wissenschaftliche) Schulen, die sich auf die Analyse überprüfbarer Fakten stützen, von
| |
| »nicht-authentischen« Schulen. Letztere setzen die Freimaurerei unzulässigerweise durch
| |
| Rückschlüsse aus dem, was später – insbesondere in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts
| |
| – zur Freimaurerei, vor allem zur Freimaurerei von Hochgradsystemen, geworden ist,
| |
| in eine direkte Beziehung zu Religionen, Mysterien, Kulten und hermetisch-esoterischen
| |
| Traditionen vergangener Jahrhunderte. Generell sind die Freimaurer immer in der Versuchung
| |
| gewesen, die Wurzeln der von ihnen in der jeweiligen freimaurerischen Gegenwart
| |
| gewollten Form der Freimaurerei in der Vergangenheit zu entdecken, um sie hierdurch zu
| |
| legitimieren.
| |
| | |
| Fest steht jedoch, dass die Symbole und Rituale der Freimaurer, die bis auf den heutigen
| |
| Tag in den Logen zur Anwendung kommen, in erster Linie den Formen- und Ideenwelten
| |
| der europäischen Bautradition, ihren organisatorischen Zusammenschlüssen, ihren Legenden
| |
| (Salomonischer Tempelbau, Baumeister Hiram, Märtyrerlegende der »Quatuor Coronati
| |
| «) sowie den Verfahren der Mitglieder der Bauhütten, sich gegenseitig als Maurer zu
| |
| erkennen, entstammen und damit insgesamt der Vorgeschichte der Freimaurerei angehören.
| |
| Dabei sind neben den englischen vor allem die schottischen Traditionen von besonderer
| |
| Bedeutung gewesen. David Stevenson hat in seiner grundlegenden Studie zu den Ursprüngen
| |
| der Freimaurerei darauf hingewiesen, dass wesentliche Elemente des Bundes – die
| |
| vor der Öffentlichkeit verborgenen Rituale, die geheimen Modalitäten der gegenseitigen
| |
| Erkennung als Maurer, die feierlichen Initiationen neuer Mitglieder sowie die Aufnahme
| |
| von Nichtmaurern in die Logen – neben praktischen Regeln für die Ausübung des Gewerbes
| |
| und sozialen Einrichtungen – bereits Mitte des 17. Jahrhunderts für die schottischen
| |
| Logen nachweisbar sind.4 Stevenson hat weiter deutlich gemacht, dass innerhalb der Rituale
| |
| neben der Bausymbolik auch esoterische Vorstellungen an Bedeutung gewannen, die
| |
| auf hermetische Traditionen der Renaissance zurückzuführen sind. Nicht zuletzt deshalb
| |
| stieß die Freimaurerei schon in ihrer Formierungsphase auf Widerstand von Vertretern
| |
| und Institutionen der etablierten christlichen Kirchen. Es ist allerdings wohl anzunehmen,
| |
| dass die frühe Hermetik in den Logen der schottischen Freimaurer nicht direkt zu den
| |
| mit allerlei zusätzlicher Symbolik rituell aufgefüllten Hochgradsystemen führte, die in der
| |
| zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts populär wurden.5 Einmal war die Hermetik in den
| |
| frühen schottischen Logen Bestandteil einer organisatorisch einfachen, noch nicht einmal
| |
| dreigradigen Freimaurerei gewesen, zum anderen hatte sie sich über längere historische
| |
| Perioden hinweg entwickelt und war insofern überlieferungsverbunden und nicht bewusst
| |
| angeeignet. Deshalb kann sie auch als wesentlich authentischer gelten als die nicht selten
| |
| gesuchte und willkürlich anmutende Esoterik in den Symbol- und Ritualkreationen der
| |
| Hochgradsysteme des späten 18. Jahrhunderts. Hermetik und Alchemie, Wahrheitssuche
| |
| 3 Hamill, John: The Craft. A History of English Freemasonry, Great Britain Crucible 1986, S. 15–25. Great
| |
| Britain Crucible 1986.
| |
| 4 Stevenson, David: The Origins of Freemasonry, Cambridge 1998.
| |
| 5 »In der Freimaurergesellschaft scheint Hermes Trismegistos in der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts
| |
| noch keine bedeutende Rolle zu spielen. Salomons Tempel oder die Tempelritter sind die wichtigsten
| |
| historischen Bezüge. In der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts ändert sich das grundsätzlich.« Ebeling,
| |
| Florian: Das Geheimnis des Hermes Trismegistos. Geschichte des Hermetismus. Mit einem Vorwort
| |
| von Jan Assmann, München 2005, S. 161.
| |
| 15
| |
| in religiösem Eklektizismus, Hoffnung auf einen »Consensus der Religionen«, all das hatte
| |
| ja für die Intellektuellen der Spätaufklärung eine beträchtliche Faszinationskraft, nicht als
| |
| feste dogmatische Lehre, sondern als »Sammelbecken unterschiedlicher nichtorthodoxer
| |
| Bild- und Gedankenfiguren«,6 die an die Stelle eines orthodoxen Christentums treten konnten.
| |
| | |
| In diesem Kontext schreibt etwa Goethe im achten Buch seiner Erinnerungsschrift
| |
| »Dichtung und Wahrheit«:
| |
| | |
| »Ich studierte fleißig die verschiedenen Meinungen, und da ich oft genug hatte sagen
| |
| hören, jeder Mensch habe am Ende doch seine eigene Religion, so kam mir nichts
| |
| natürlicher vor, als dass ich mir auch meine eigene bilden könne, und dieses that ich
| |
| mit vieler Behaglichkeit. Der neue Platonismus lag zum Grunde; das Hermetische,
| |
| Mystische, Kabbalistische gab auch seinen Beitrag her, und so erbaute ich mir eine
| |
| Welt, die seltsam genug aussah.«7
| |
| Es kann wohl auch davon ausgegangen werden, dass es den Übergang von der »operativen«
| |
| (bauhandwerklichen) zur »spekulativen« (symbolisch-philosophischen) Freimaurerei in der
| |
| bisher angenommenen Form als einer, vor allem auf das 17. Jahrhundert datierten zeitlichen
| |
| Abfolge nicht gegeben hat. Die Bauhütten waren bereits lange vor dem Entstehen der Freimaurerei
| |
| als moderner Sozialform »spekulativ«, und gerade dies hat die berufsfremden Außenstehenden,
| |
| die in zunehmender Zahl als »Angenommene Maurer« (»accepted masons«)
| |
| hinzukamen, stark angezogen. Ernst Bloch etwa hat auf die Bedeutung der über Rohstoffe,
| |
| Technik und Zwecke der Bauten, insbesondere auch der sakralen Bauten, hinausgehenden
| |
| Bauideen und Bausymbole, das in den Bauhütten lebendige »Kunstwollen«, im Architekturkapitel
| |
| (»Bauten, die eine bessere Welt abbilden, architektonische Utopien«) seines monumentalen
| |
| Werkes »Das Prinzip Hoffnung« hingewiesen:
| |
| »Damals war ein anderes Kunstwollen am Werk als das der sogenannten Zweckkunst,
| |
| und weil es ein Kunst-Wollen war, zeigte es außer Rohstoff, Technik, Zweck die wichtigste
| |
| Bestimmung: die der Phantasie. Es war hier diejenige der kanonischen Bauvollkommenheit,
| |
| im Hinblick auf ein geglaubtes symbolisches Vorbild. Dieses Vorbild
| |
| leitete gerade die Ausführung des Werks, nicht nur, wie der Archetyp, seinen Traum
| |
| und Plan ante rem, es gab den Meisterregeln selber die Regel. Daher war das jeweilige
| |
| große architektonische Kunstwollen das gleiche wie die jeweilige Symbolintention,
| |
| die in der Ideologie des alten Bauhandwerks traditionell wirksam war. Diese Intention
| |
| aber suchte mit Dreieck und Zirkel ›den Maßen eines als vorbildlich imaginierten
| |
| Daseins-Baus überhaupt abbildlich näherzukommen‹« (Hervorhebung von
| |
| E. Bloch).8
| |
| | |
| 6 Hermetik, Eklektik, Consensus, www.jgoethe.uni-muenchen.de/…/hermetik.html, download 17.03.2011.
| |
| 7 Goethe, Johann Wolfgang: Aus meinem Leben. Dichtung und Wahrheit, Zweiter Teil, Achtes Buch, in:
| |
| Heinemann, Karl: Goethes Werke, Zwölfter Band, Leipzig und Wien o.J., S. 387.
| |
| 8 Bloch, Ernst: Das Prinzip Hoffnung, Zweiter Band, Frankfurt am Main 1982, S. 837. Blochs Verhältnis
| |
| zur Freimaurerei ist ambivalent: »Wie bekannt, gebraucht die Maurerei sowohl die Abzeichen des Baugewerks
| |
| wie vor allem: sie phantasiert ihre Geschichte durch die gesamte Baugeschichte hindurch. Es
| |
| ist höchst unwahrscheinlich, daß diese bürgerlich-edelmännische Verbrüderung selber … aus der Werkmaurerei
| |
| hervorgegangen ist. Aber es ist noch unwahrscheinlicher, daß sie die grundlegende architektonische
| |
| Gleichnis-Spielerei, die sie gebraucht, rein aus sich heraus erfunden hat.« Ebenda, S. 838f.
| |
| 16
| |
| Die Tatsache, dass bereits im 17. Jahrhundert Logen im späteren Sinne existierten, deutet
| |
| darauf hin, dass der Bund aus historischen Kontinuitäten hervorgegangen ist, und dass es
| |
| insofern nur bedingt zutreffend ist, den meist genannten Stichtag für den Übergang von
| |
| der Vorgeschichte zur Geschichte der Freimaurerei, den 24. Juni 1717, als sich vier Londoner
| |
| Logen zur ersten Großloge der Welt zusammenschlossen, als Gründungsdatum der modernen
| |
| Freimaurerei herauszustellen, ganz abgesehen davon, dass kaum belastbare Quellen für
| |
| Datum und Ereignis vorhanden sind.9 Dennoch war die Londoner Gründung von großer, ja
| |
| ausschlaggebender Bedeutung für die weitere Entwicklung der Freimaurerei. Denn mit der
| |
| Großloge von London und Westminster begann die logenübergreifende Institutionalisierung
| |
| und inhaltliche Ausrichtung der Freimaurerei, die die organisatorischen und konzeptionellen
| |
| Grundlagen für die nun einsetzende dynamische Entwicklung der Freimaurerei in
| |
| England und sehr bald auch über England hinaus geschaffen hat. Die Londoner Großloge
| |
| gab sich 1723 ihre erste Verfassung, die nach ihrem Verfasser, dem aus Schottland stammenden
| |
| presbyterianischen Geistlichen James Anderson, die »Andersonschen Konstitutionen
| |
| « genannt werden, konzeptionell aber sehr wesentlich auf den eigentlichen Vater der
| |
| modernen Freimaurerei, John Theophilius Desaguliers (1683–1744) zurückgehen.10 Desaguliers
| |
| wurde 1719 zum dritten Großmeister der Londoner Vereinigung gewählt. Er war französischer
| |
| Emigrant und protestantischer Geistlicher, gehörte zum Freundeskreis von Isaac
| |
| Newton, war als Naturphilosoph Mitglied der Londoner »Royal Society« und führte dem
| |
| Freimaurerbund mit dem Herzog John von Montague den ersten bedeutenden Vertreter des
| |
| englischen Hochadels zu, der dann selbst 1721 Großmeister wurde.
| |
| | |
| | |
| In Deutschland sind die »Andersonschen Konstitutionen« als die »Alten Pflichten«
| |
| bekannt und richtungweisend geworden.11 Programmatisch ist vor allem die erste dieser
| |
| Pflichten mit der Überschrift: »Von Gott und der Religion«:
| |
| »Der Maurer ist als Maurer verpflichtet, dem Sittengesetz zu gehorchen; und wenn
| |
| er die Kunst recht versteht, wird er weder ein engstirniger Gottesleugner, noch ein
| |
| bindungsloser Freigeist sein. In alten Zeiten waren die Maurer in jedem Land zwar
| |
| verpflichtet, der Religion anzugehören, die in ihrem Lande oder Volke galt, heute
| |
| jedoch hält man es für ratsamer, sie nur zu der Religion zu verpflichten, in der alle
| |
| Menschen übereinstimmen, und jedem seine besonderen Überzeugungen selbst zu
| |
| belassen. Sie sollen also gute und redliche Männer sein, Männer von Ehre und Anstand,
| |
| ohne Rücksicht auf ihr Bekenntnis oder darauf, welche Überzeugungen sie
| |
| sonst vertreten mögen. So wird die Freimaurerei zu einer Stätte der Einigung und
| |
| zu einem Mittel, wahre Freundschaft unter Menschen zu stiften, die einander sonst
| |
| ständig fremd geblieben wären.«
| |
| Die »Alten Pflichten« enthalten tatsächlich die bis in die Gegenwart gültigen Grundlagen
| |
| der Freimaurerei: Die moralische Verpflichtung des Maurers, den von ihm geforderten Ha-
| |
| 9 Hinweise finden sich in der zweiten Ausgabe der »Konstitutionen« von 1738.
| |
| 10 Vgl. hierzu und zum folgenden Voges, Michael: Aufklärung und Geheimnis. Untersuchungen zur Vermittlung
| |
| von Literatur- und Sozialgeschichte am Beispiel der Aneignung des Geheimbundmaterials im
| |
| Roman des späten 18. Jahrhunderts, Tübingen 1987, S. 24.
| |
| 11 Eine Wiedergabe der »Alten Pflichten« findet sich in: Lennhoff, Eugen/Posner, Oskar/Binder, Dieter
| |
| A.: Internationales Freimaurer Lexikon, München 2000, S. 16–23.
| |
| 17
| |
| bitus von Ehre und Anstand, den Verzicht auf trennende religiöse Festlegungen und die Praxis
| |
| der Toleranz als Grundlage von Einigkeit und Freundschaft.
| |
| Nach der Gründung der ersten Londoner Großloge im Jahre 1717, zu der 1751 eine
| |
| zweite, die »Grand Lodge of Ancients« hinzukam12, erfolgte eine stürmische Entwicklung
| |
| der Freimaurerei. In England, Schottland und Irland – als den Heimatländern der modernen
| |
| Freimaurerei – wuchs die Zahl der Logen bis zum Ende des 18. Jahrhunderts auf über
| |
| 1000 an.13 Schnell griff die Freimaurerei auf die überseeischen Gebiete Großbritanniens
| |
| über, insbesondere auf die amerikanischen Kolonien, die späteren Vereinigten Staaten. 1733
| |
| wurde von England aus die Provinzial-Großloge von Massachusetts in Boston eingesetzt.
| |
| Wenige Jahrzehnte später sollten Freimaurer in der amerikanischen Unabhängigkeitsbewegung
| |
| sowie der Verfassungsgeschichte der USA eine führende Rolle spielen.14
| |
| Auch auf dem europäischen Kontinent breitete sich die Freimaurerei rasch aus. Wie in
| |
| England fanden die Ideen, Organisationsformen und Symbole des Bundes eine große Resonanz.
| |
| Selbst der schon früh einsetzende Widerstand der katholischen Kirche konnte seine
| |
| Ausbreitung nicht verhindern, zumal die päpstlichen Verurteilungen nicht in allen Bistümern
| |
| veröffentlicht wurden und viele hochrangige katholische Geistliche dem Freimaurerbund
| |
| angehörten. Das erste Land außerhalb Großbritanniens, in dem die Freimaurerei
| |
| auf breiter Basis Fuß fasste, war Frankreich. Spuren von Logengründungen in Paris lassen
| |
| sich bis in das Jahr 1725 zurückverfolgen. Aufklärerische Diskursfreude, später aber auch
| |
| die Neigung zu phantasievollen Hochgradsystemen, waren kennzeichnend für die weitere
| |
| Entwicklung der französischen Freimaurerei. Bedeutsam war auch die Entwicklung der
| |
| Freimaurerei in den Niederlanden, wo nach 1731 zahlreiche Logen entstanden. In diesem
| |
| Jahr war im Haag Herzog Franz Stephan von Lothringen, später Ehegatte Maria Theresias
| |
| und als Franz I. römisch-deutscher Kaiser, von einer Deputation hochrangiger englischer
| |
| Freimaurer in den Freimaurerbund aufgenommen worden.
| |
| | |
| | |
| Die erste Loge in Deutschland entstand 1737 in Hamburg (Loge en Hambourg, seit
| |
| 1743 »Absalom«, heute »Absalom zu den drei Nesseln«). Bald folgten Logengründungen in
| |
| Dresden, Berlin, Bayreuth und Leipzig. Der preußische Kronprinz Friedrich (der spätere
| |
| Friedrich der Große) wurde bereits 1738 in die Freimaurerei aufgenommen. Die quantitative
| |
| Dynamik der deutschen Freimaurerei war bis in die zweite Hälfte des 20. Jahrhunderts
| |
| hinein beträchtlich. In Deutschland, im »alten Reich«, wurden in den ersten 50 Jahren der
| |
| Existenz
| |
| von Logen, d.h. von 1737 bis 1787, rd. 400 Logen gegründet, in denen ca. 25.000
| |
| Mitgliederaufnahmen stattfanden. Zu einer weiteren Gründungswelle kam es im (neuen)
| |
| Deutschen Reich nach 1871. So entstanden zwischen 1871 und 1925 weitere 300 Logen,
| |
| und die Zahl der Mitglieder aller deutschen Logen erreichte Mitte der 1920er Jahre ihren
| |
| Höchststand mit über 80.000. Dabei dominierten die »altpreußischen« Großlogen mit
| |
| annähernd 70 Prozent der deutschen Freimaurer. Zwar hatte der Zusammenbruch der
| |
| 12 Die Großloge der »Ancients« beanspruchte die größere freimaurerische Legitimität für sich und nannte
| |
| die Gründung von 1717 abwertend Großloge der »Moderns«. Im Jahre 1813 schlossen sich beide Großlogen
| |
| zur »United Grandloge of England« zusammen, in der die Tradtion der »Ancients« dominierte.
| |
| 13 Vgl. Clark, Peter: British Clubs and Societies 1580–1800. The Origins of an Associational World, New
| |
| York 2000, S. 309–349.
| |
| 14 Vgl. Bullock, Steven C: Revolutionary Brotherhood – Freemasonry and the Transformation of the American
| |
| Social Order 1730–1840, Chapel 1996; Hodapp, Christopher: Solomon’s Builders: Freemasons,
| |
| Founding Fathers and the Secrets of Washington D.C., Berkeley CA 2007.
| |
| 18
| |
| Hohenzollern-Monarchie kaum negativen Einfluss auf die Expansion der Großlogen – der
| |
| Zustrom zu den Logen war vielmehr nach 1918 besonders stark –, doch führte die Loyalität
| |
| mit den untergegangenen königlichen Protektoren bei einer generell vorwiegend nationalkonservativen
| |
| Einstellung der meisten deutschen Freimaurer zu einer oft feindlichen,
| |
| bestenfalls abwartend indifferenten Einstellung zur Weimarer Republik.15 Gleichzeitig war
| |
| das deutsche Großlogensystem stark zersplittert. 1933 – vor dem Untergang in der NS-Zeit
| |
| – bestanden in Deutschland elf Großlogen, von denen allerdings zwei – der Freimaurerbund
| |
| zur Aufgehenden Sonne und die Symbolische Großloge von Deutschland – von den
| |
| anderen nicht als regulär anerkannt wurden.16
| |
| Die soziale Zusammensetzung der deutschen Logen war durch den dominierenden
| |
| Anteil des »gehobenen Bürgertums« bestimmt (Beamte und – oft ehemalige – Offiziere;
| |
| Wissenschaftler, Lehrer, Künstler; Unternehmer, Banker, leitende Angestellte). Die religiöse
| |
| Struktur war vorwiegend protestantisch: Die Loge »Apollo« in Leipzig z.B. hatte im
| |
| Jahre 1906 89,2 Prozent evangelisch-lutherische, 3,2 Prozent katholische und 6,0 Prozent
| |
| jüdische Mitglieder.17 Die jüdischen Mitglieder in »humanitären« Großlogen beliefen sich
| |
| – so ermittelte und schrieb der »Verein deutscher Freimaurer« in einer Erwiderungsschrift18
| |
| auf Ludendorffs Antifreimaurerpamphlet »Vernichtung der Freimaurerei durch Enthüllung
| |
| ihrer Geheimnisse« – Ende der zwanziger Jahre auf ca. 3000. Bei 24.000 Mitgliedern der
| |
| »humanitären« Großlogen in Deutschland würde dies einen beträchtlichen jüdischen Anteil
| |
| bedeuten und unterstreichen, wie sehr sich deutsche Juden vor der Nazi-Katastrophe
| |
| als deutsche Bürger fühlten und an Assoziationen des deutschen Bürgertums Anteil hatten.
| |
| Freimaurerei als gesellschaftliches Erfolgsmodell – warum?
| |
| Die für die dynamische Entwicklung der modernen Freimaurerei in den ersten Jahrzehnten
| |
| nach ihrer Begründung bestimmenden Faktoren lassen sich mit den Stichworten »historische
| |
| Erinnerung« und »gesellschaftlicher Wandel« umschreiben. »Historische Erinnerung«
| |
| bedeutet vor allem Erinnerung an die europäischen Religionskriege des 16. und 17. Jahrhunderts,
| |
| die zu einem hohen Toleranzbedarf und zur Sehnsucht nach gesellschaftlichen Brückenschlägen
| |
| zwischen den religiös zerstrittenen Parteien geführt hatten. »Gesellschaftlicher
| |
| Wandel« meint zunächst den vieldimensionalen Prozess der Säkularisierung, Individualisierung
| |
| und Autonomisierung, der im 18. Jahrhundert mit Macht einsetzte. Dieser Wandel von
| |
| Sinnstrukturen und Weltdeutungen ging mit tiefgreifenden Veränderungen der sozialen und
| |
| ökonomischen Verhältnisse einher. Die zunehmende standesmäßige und berufliche Differenzierung
| |
| der Gesellschaft, die sozio-politischen Funktionsverlagerungen auch beim Adel,
| |
| das allmähliche Entstehen von Bürgertum und modernen kapitalistischen Wirtschaftsformen,
| |
| das erhöhte Bildungsangebot, die Urbanisierung und die – unter dem Vorzeichen
| |
| 15 Vgl. Höhmann, Hans-Hermann: Europas verlorener Friede, die national-völkische Orientierung innerhalb
| |
| der deutschen Freimaurerei und die »freimaurerische Erinnerungspolitik« nach dem Zweiten Weltkrieg,
| |
| in diesem Band, S. 51–87.
| |
| 16 Vgl. Steffens, Manfred: Freimaurerei in Deutschland. Bilanz eines Vierteljahrtausends, Flensburg 1964.
| |
| 17 Hoffmann, Stefan-Ludwig: Die Politik der Geselligkeit, a.a.O., S. 368.
| |
| 18 Die Vernichtung der Unwahrheiten über die Freimaurerei durch 116 Antworten auf 116 Fragen, herausgegeben
| |
| vom Verein deutscher Freimaurer, Leipzig 1928, S. 33.
| |
| | |
| 19
| |
| des europäischen Kolonialismus – sich auch international, ja interkontinental verstärkende
| |
| räumliche Mobilität: all das führte dazu, dass Menschen aus ihren traditionellen Bindungen
| |
| und sozialen Verankerungen gelöst wurden und auch in der Wahrnehmung ihres eigenen
| |
| Selbst über Generationen hinweg praktizierte Deutungsmuster ablegen mussten.19 Diese Veränderungen
| |
| führten nicht nur zu Verunsicherungen, ja Krisen. Sie ließen auch eine ausgeprägte
| |
| Neigung entstehen, neue Einstellungs-, Bindungs- und Verhaltensoptionen aufzuspüren
| |
| und zu nutzen. Es entwickelte sich eine Nachfrage nach neuen Formen von gesellschaftlichen
| |
| Vernetzungen – modern ausgedrückt nach neuen Formen von »sozialem Kapital«
| |
| – und so wurde das 18. Jahrhundert zur Epoche der Assoziationsbildung und Geselligkeit.
| |
| Die Freimaurerei erwies sich offensichtlich als eine besonders attraktive Form neuer gesellschaftlicher
| |
| Einbindung. Dies resultierte ebenso aus der breiten Nutzbarkeit des Bundes
| |
| für die Befriedigung vieler sozialer, weltanschaulicher, religiöser und politischer Bedürfnisse
| |
| wie aus der Möglichkeit, die Logen und Logensysteme durch Veränderungen weiterzuentwickeln
| |
| und an konkrete Bedürfnisse anzupassen. Es waren vor allem vier Funktionen, oder
| |
| besser: Funktionsgruppen, welche die Freimaurerei rasch zu einer gesamteuropäischen sozialen
| |
| und kulturellen Bewegung werden ließen:
| |
| • die soziale Funktion, Menschen über Standesgrenzen hinweg als »bloße Menschen« (Lessing),
| |
| als Mitmenschen, als Menschenbrüder zusammenzuführen und ihnen neue gesellschaftliche
| |
| Netzwerke, neue Geltungs- und Selbstverwirklichungsmöglichkeiten sowie
| |
| neue Formen von Geselligkeit und Unterhaltung anzubieten;
| |
| • die ideell-geistesgeschichtliche Funktion, Menschen dazu aufzufordern, sich der eigenen
| |
| Vernunft zu bedienen, sich am autonomen Gewissen zu orientieren und im Sinne eines
| |
| »nichts geht über das laut denken mit einem Freunde« (Lessing) nach dem jeweiligen freimaurerischen
| |
| Grundverständnis den Diskurs über die Ideen der Aufklärung und andere,
| |
| vor allem das Ritual und die als »Hieroglyphen« verstandenen Symbole20 betreffende
| |
| Themen zu führen;
| |
| • die religiöse Funktion, Menschen durch ein neues, aber auf alten Wurzeln beruhendes,
| |
| zunehmend esoterisch ausgerichtetes Symbolsystem eine optimistisch-positive Einstellung
| |
| zu sich selbst, zum Kosmos und zur Transzendenz zu vermitteln und die im 18.
| |
| Jahrhundert weit verbreitete Unzufriedenheit mit dem etablierten Kirchentum zu kompensieren,
| |
| und
| |
| • die politische Funktion, Menschen in den Logen der absolutistisch verfassten Gesellschaft
| |
| einen unabhängigen »Moralischen Innenraum« (Reinhart Koselleck) zu bieten, in dem
| |
| das »Geheimnis der Freiheit« als »Freiheit im Geheimen« erlebt werden konnte, in dem
| |
| es später aber auch – etwa im Falle der »Strikten Observanz« und der mit der Freimaurerei
| |
| verbundenen Illuminaten – zu politischen Instrumentalisierungen der Freimaurerei
| |
| kommen konnte.
| |
| Es kann nicht überraschen, dass dieses ja durchaus nicht homogene Bündel von Motiven
| |
| bald zu mannigfaltigen Veränderungen und Verzweigungen der Freimaurerei geführt hat.
| |
| Adolph Freiherr Knigge, Zeitzeuge und Mitgestalter als Freimaurer, Illuminat und kritischer
| |
| 19 Vgl. van der Loo, Hans/van Reijen, Willem: Modernisierung. Projekt und Paradox, München 1992, S. 62f.
| |
| 20 Vgl. Maurice, Florian: Freimaurerei um 1800. Ignaz Aurelius Feßler und die Reform der Großloge Royal
| |
| York in Berlin, Tübingen 1997, S. 31f.
| |
| 20
| |
| Geist, beschrieb die masonische Landschaft im kontinentalen Europa der zweiten Hälfte des
| |
| 18. Jahrhunderts folgendermaßen:
| |
| | |
| »Man weiß, dass es Freymaurer-Systeme gibt, deren ganze Verfassung auf politische
| |
| Pläne und Einwirkung in die Staaten beruht; man weiß, dass es andere gibt, die dergleichen
| |
| Operationen als schädlich und unerlaubt verbannen.
| |
| Man weiß, dass es Systeme gibt, welche die Einführung einer natürlichen allgemeinen
| |
| Religion zum Endzweck haben, und selbst die Lehre Jesu nach dieser Art erklären;
| |
| man weiß, dass es andere gibt, welche die Aufrechterhaltung der geoffenbarten
| |
| christlichen Religion zum Grundpfeiler machen.
| |
| Man weiß, dass es Systeme gibt, welche speculative Wissenschaften zum Gegenstand
| |
| des Ordens machen; man weiß, dass andere die Grenzen der Maurerey auf mögliche
| |
| Tätigkeit zum Guten einschränken.
| |
| Man weiß, dass jene besondere Überlieferungen in der Hieroglyphen-Sprache (zu
| |
| entdecken glauben), wo diese nur nach conventionellen Zeichen zu Beförderung
| |
| grösserer Vereinigung suchen, folglich jene in den Geheimnissen die Hauptsache,
| |
| diese
| |
| (in ihnen) nur (einen) Mittelzweck finden.
| |
| Man weiß, dass einige Systeme, alles was gut und edel ist, als einen Gegenstand des
| |
| Ordens ansehen; andere hingegen nur einen einzigen, bestimmten, speciellen Zwecke
| |
| nachzustreben (für) rathsam halten; dass einige die möglichste Ausbreitung suchen;
| |
| andere sich auf eine kleine bestimmte Zahl einschränken.
| |
| Jedes dieser Systeme muss natürlicherweise in der Art, ihre Zöglinge zu bilden, in ihren
| |
| Aufnahmen, in der Wahl der Mitglieder, in ihren Reden, Handlungen und in den
| |
| Mitteln, welche sie wählen, einen Weg einschlagen, der oft dem schnurgerade entgegen
| |
| ist, worauf andre wandeln.
| |
| Wie werden sie je in einem Punkt zusammentreffen?«21
| |
| Auf dem Hintergrund dieser Entwicklung muss auch die gern betonte Beziehung der Freimaurerei
| |
| zur Aufklärung problematisiert werden. Freimaurerlogen konnten durchaus im
| |
| Sinne der Aufklärung Modelle bürgerlicher Gesellschaft sein, in denen sich bürgerliche
| |
| Moral diskursiv erarbeiten und im Miteinander der Brüder praktisch verwirklichen ließ.
| |
| Geheimnis und Geheimhaltung dienten dabei als Schutz, weil die politischen Verhältnisse
| |
| ein öffentliches Verfolgen derartiger Absichten noch nicht zuließen.22 Dies bedeutet jedoch
| |
| nicht, dass die Mitglieder der Logen, die Logen selbst oder gar die sich im Verlauf des 18.
| |
| Jahrhunderts herausbildenden freimaurerischen Systeme durchweg und generell »Beförderer
| |
| der Aufklärung«23 waren. Aufklärung war eine Möglichkeit unter vielen. Aufklärer »konnten
| |
| die Freimaurerlogen als Möglichkeit des lokalen Zusammenkommens nutzen«, doch
| |
| 21 Versuch über die Freymaurerey, oder Von dem wesentlichen Grundzwecke des Freymaurer-Ordens; von
| |
| der Möglichkeit einer Vereinigung seiner verschiedenen Systeme und Zweige; von derjenigen Verfassung,
| |
| welche diesen vereinigten Systemen die zuträglicheste seyn würde; und von den Maurerischen gesetzen.
| |
| Aus dem Französischen des Br. B. *** übersetzt durch den Br A.R. v. S. 1785 (5785), S. VI—VIII.
| |
| 22 Vgl. hierzu und zum folgenden Vierhaus, Rudolf: Aufklärung und Freimaurerei in Deutschland, in:
| |
| ders.: Deutschland im 18. Jahrhundert. Politische Verfassung, soziales Gefüge, geistige Bewegungen, Göttingen
| |
| 1987, S. 110–125, hier S. 118.
| |
| 23 Vgl. die Beiträge in: Balász, Éva, H./Hammermayer, Ludwig/Wagner, Hans/Wojtowicz, Jerzy: Beförderer
| |
| der Aufklärung in Mittel- und Osteuropa. Freimaurer, Gesellschaften, Clubs, Berlin 1979.
| |
| 21
| |
| umgekehrt waren »die Logen nicht auf die Aufklärung als Inhalt angewiesen«, und auch die
| |
| Betrachter, die gern einen durchgehend engen Zusammenhang zwischen Freimaurerei und
| |
| Aufklärung feststellen würden, müssen der Feststellung von Rudolf Vierhaus zustimmen,
| |
| dass auch ganz andere als Aufklärungsgedanken in die Freimaurerei eingeströmt sind, selbst
| |
| solche, die direkt anti-aufklärerischen Charakter hatten. Für Vierhaus wurde dieser Einstrom
| |
| durch diejenige Tendenz der Freimaurerei begünstigt, »die neben dem Versinken in bloße
| |
| Honoratiorengeselligkeit ihre größte Gefahr ausmacht: die Anfälligkeit für Esoterik, Pseudomystik
| |
| und Geheimnistuerei als Ausdruck einer selbst beigelegten, nach außen nicht rechtfertigungsbedürftigen
| |
| Bedeutsamkeit«.24
| |